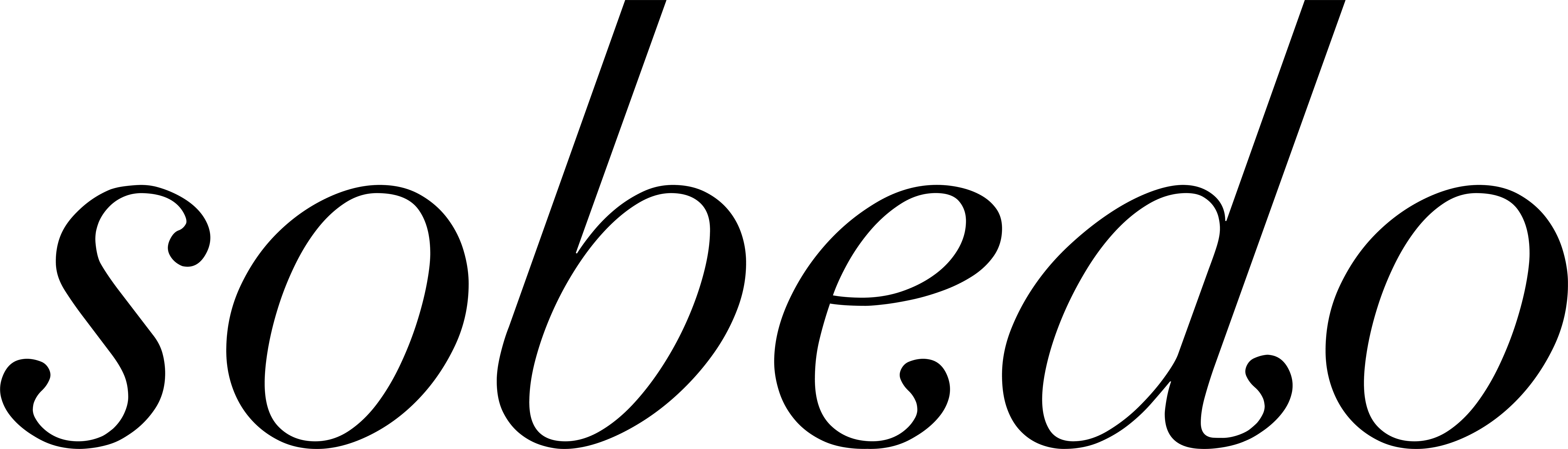Triumph des Betongebirges
Das Büro überlässt er noch immer nicht seinen drei Architektensöhnen. Fast täglich kommt der Patriarch trotz des biblischen Alters vorbei, schaut über die Entwürfe, kommentiert das eine oder andere Projekt. So haben es schon sein Großvater Alois und Vater Dominikus gemacht, beide Architekten und Liebhaber von Sakralbauten. „Für meinen Vater war vieles ungewohnt, was ich so gemacht habe“, meint Böhm, „aber er hat den Wert erkannt und versucht, das richtig zu lenken. Und so mache ich das mit meinen Söhnen hoffentlich auch.“
Kein Wunder also, dass sich der junge Gottfried, im Krieg in Russland schwer verwundet, einen Namen genau in der bevorzugten Disziplin seines Vaters machte, angefangen 1947 mit der Kapelle „Madonna in den Trümmern“ in den Ruinen der kriegszerstörten Kirche St. Kolumba in der Kölner Innenstadt. An dieses Erstlingswerk schloss sich ein halbjähriger USA-Aufenthalt an und die Bekanntschaft mit Walter Gropius und Mies van der Rohe, Vorbilder, deren Maximen der Anfänger für seine eigene Herangehensweise weiterentwickeln sollte. Zurück in Köln, fokussierte sich Böhm auf sakrale Tragwerk-Konstruktionen. Sie animierten den Architekten mit Zweitdiplom in Bildhauerei zu Experimenten, ob in der Gestalt von Schalen und Faltwerken, Hängedächern, Membrandecken oder Zeltstrukturen, die dem Brutalismus nahestanden. Stets haftete ihnen etwas Organisches an, flankiert von einer ordnenden Geometrie.
Unter den rund 70 katholischen Kirchen, die auf Böhms Konto gehen, ragt der Mariendom im bergischen Wallfahrtsort Neviges heraus. Der skulpturale Sichtbetonbau gibt im Innern einen Raum frei, der die Schwerkraft der expressiven Hülle dank einer raffinierten Dachkonstruktion zum Schweben bringt. Die Emporen und Nischen sind in die Wände eingearbeitet. In die Entstehungszeit dieses Meilensteins der Architekturgeschichte entführt gerade eine Ausstellung im Frankfurter DAM mit neuen Archivfunden, einem Ausblick in die Zukunft und einem umfangreichem Vortragsprogramm.
Zwischen Tradition und Moderne oszilliert auch Böhms erster Profanbau, das Bensberger Rathaus, das an die Überreste der mittelalterlichen Burg anschließt und mit einem sich aufgipfelnden Treppenturm einen zeitgemäßen Touch bekommt. Kaum ein Bau aus Böhms Hand kommt zu dieser Zeit ohne Beton aus. Erst später stellt sich heraus, dass dieser scheinbar robuste Baustoff auch seine Schwächen hatte. Die Außenmauern mussten nicht selten schon nach wenigen Jahren restauriert werden. Der Beton war durch die Witterungsverhältnisse rissig geworden.
Vielleicht wandte sich Böhm Anfang der 1970er Jahre deshalb anderen Materialien zu. Stahl und Glas prägten jetzt seine Verwaltungsbauten, Museen, Theater und Siedlungen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus, darunter auch einige Gebäude in der Kölner Trabantenstadt Chorweiler, die heute mit ihren gesammelten Bausünden als sozialer Brennpunkt gilt. Nicht nur diese Wohnsilos lösten Diskussionen aus. Das Diözesanmuseum in Paderborn etwa war ursprünglich als revolutionärer Bau gedacht, der sich von der klassischen Abfolge von Sälen und Kabinetten löste und die Verkehrsflächen zur Ausstellungsfläche machte.
Die Stahlkonstruktion mit einem zum Domplatz verglasten Erdgeschoss fiel durch seine Bleiverkleidung auf, was ihr den wenig schmeichelhaften Beinamen „Blechbüchse“ bescherte. Dass der Bau funktionale Mängel aufwies, trug nicht gerade zu seiner Akzeptanz bei. Klimatisch verursachte die ungewöhnliche Fassade entweder eine Auskühlung oder Überhitzung des Innenraums. Die sensiblen Objekte waren die Leidtragenden. Das Erzbischöfliche Generalvikariat entschied sich 1992 schließlich für einen Umbau durch den amerikanischen Architekten Michael Brawne.
2004 dann die leichtfüßigere Ulmer Stadtbibliothek, eine gläserne Pyramide, die sich in ihre Umgebung aus steilgiebigen Bürgerhäusern elegant einfügt. Eine ähnlich transparente Glaskuppel plante Böhm für den Berliner Reichstag, die dann bekanntlich Norman Foster umsetzen durfte. Mit dem Dekonstruktivismus flirtete er acht Jahre später etwas einfallslos beim Bau der WDR-Arkaden, einer ornamental anmutenden Ansammlung gestapelter Container. Entworfen mit seiner 2012 gestorbenen Frau Elisabeth, ebenfalls Architektin, konnte dieses verspielte Spätwerk nicht an die frühen Erfolge anschließen.
Ob nüchtern oder verziert, kantig oder rund – bei Böhm ist keine Form mit einem Tabu belegt. Das verhindert mitunter eine eigene Handschrift und rutscht auch schon mal in die Kategorie Effekthascherei, wie etwa bei dem Potsdamer Hans-Otto-Theater, der mit seinen drei roten, scheinbar rotierenden Dachscheiben um Aufmerksamkeit buhlt. Den Auftrag bekam Böhm in seinen Achtzigern. Dass seine Gestaltungslust ein Ende finden könnte, daran zweifelt der täglich schwimmende Senior vehement: „Architektur ist ja keine Arbeit in dem Sinne, wie Leute in anderen Berufen arbeiten müssen“, glaubt er. „Sie ist zwar oft mit Ärger und Verdruss verbunden, aber auch immer wieder mit Freude.“
Text: Alexandra Wach